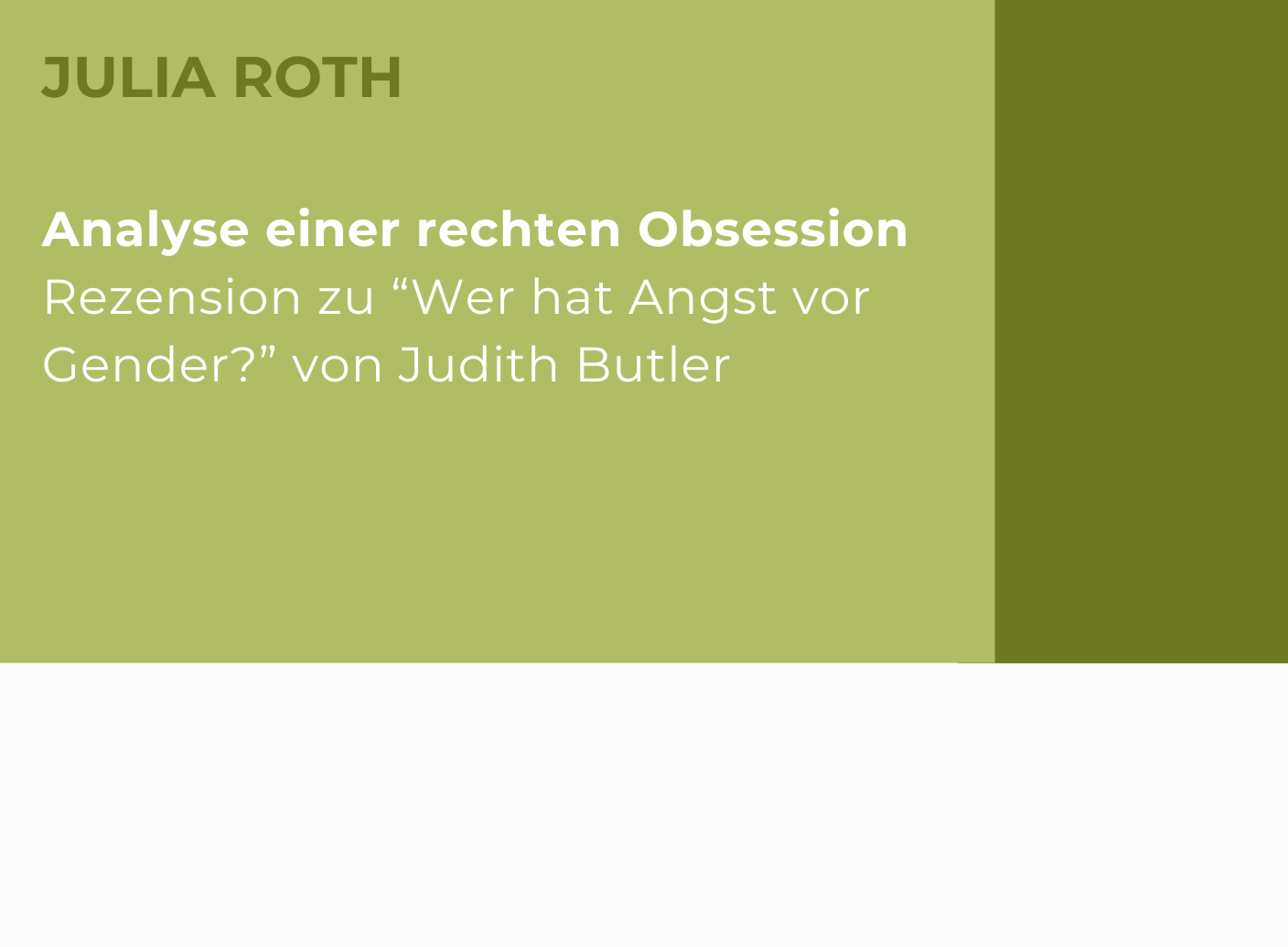Originaltext hier.
Julia Roth | Rezension | 22.10.2025
(editierte Version mit den korrigierten Pronomen für Judith Butler und durchgängige gender-inklusive Sprache)
In dem Stück „Who’s Afraid of Virginia Woolf” des US-amerikanischen Dramatikers Edward Albee wird das Ideal der perfekten heteronormativen Familie radikal zerschlagen. Der Titel des berühmten, seit seiner Premiere im Jahr 1962 bis heute immer wieder aufgeführten Theaterstücks zitiert den Namen der britischen feministischen Autorin Virginia Woolf und variiert zugleich den Refrain des Liedes „Who’s Afraid of the Big Bad Wolf“ aus Walt Disneys Zeichentrickfilm „Three Little Pigs” (1933). Bei Disney tritt der große böse Wolf ,im Schafspelz‘ auf und ist nicht gleich als die Gefahr zu erkennen, als die ihn das klügste der drei Schweinchen imaginiert.
Damit wären wir bei einem der zentralen Themen von Butlers Buch, dessen englischer Originaltitel auf Albees Stück anspielt: der Wirkung von Ängsten. Während die Angst des Schweinchens aus dem Disney-Film auf einer realen Gefahr beruht, die die Schweinchen trotz unterschiedlicher Wahrnehmung gemeinsam besiegen, beschäftigt sich Butler intensiv mit Ängsten, die auf Projektionen beruhen. Das Konzept, mit dessen Hilfe Butler diese Ängste im Anschluss an Lacans Konzept des Imaginären untersucht, ist das des Phantasmas. Das Phantasma „Gender” adressiert Butler zufolge vielfältige unbegründete Ängste in Bezug auf Sexualität sowie auf Geschlechterrollen und -beziehungen. Gleichzeitig rückt dieses Phantasma begründete Ängste vor Krieg, wirtschaftlicher Ungleichheit, Klimawandel und den damit verbundenen Existenzbedrohungen in den Hintergrund. In zehn Kapiteln zeichnet Butler nach, wie einflussreiche Akteur*innen aus dem rechten Spektrum mit Hilfe des Genderphantasmas gezielt Ängste schüren und Stimmung gegen Frauen und Minderheiten machen, um so von gesellschaftlichen Problemen abzulenken, an denen sie mitschuldig sind. Seit der Vatikan in den 1990er-Jahren den Begriff der „Gender-Ideologie” prägte, ist eine globale Szene entstanden, die Butler als „Anti-Gender-Bewegung” (S. 11) bezeichnet. Diese kämpft gegen die vermeintliche Bedrohung traditioneller Familien und hat – beginnend in Lateinamerika – weltweit mächtige Bündnisse zwischen unterschiedlichen religiösen Akteur*innen geschmiedet, zuvorderst zwischen Katholik*innen und Evangelikal*innen. In den USA setzte die Opposition gegen die „Gender-Ideologie” erst relativ spät ein, was Butler unter anderem auf die häufigere alltagssprachliche Verwendung des Begriffs zurückführt. Unter Verweis auf die einschlägigen Studien von Mary Anne Case[1] zeichnet Butler nach, wie zuletzt Papst Franziskus die „Gender-Ideologie” als „Atomwaffe” und Form der „Kolonisierung” durch den übermächtigen Westen verteufelte[2] und die Kritik so anschlussfähig für Länder aus dem sogenannten Globalen Süden machte. Unter dem Vorwand, Schaden von anderen abzuwenden, so Butler, sprächen religiöse und extrem rechte Kräfte Frauen, Kindern und Familien Rechte ab. Butler sieht in dieser Verschiebung und Umkehrung eine wahnwitzige Ironie und einen „moralisierenden Sadismus” am Werk (S. 22), da ausgerechnet die katholische Kirche, die selbst seit Jahrzehnten für sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen verantwortlich sei, unter dem Deckmantel des Kinderschutzes dazu beitrage, LGBTQIA+-Personen und deren Familien ihre Rechte zu entziehen.
Erhellend ist Butlers Analyse der Muster von Anti-Gender-Diskursen in ehemals kolonisierten Ländern Afrikas und Lateinamerikas, wo Butler den Rechtsruck unter Berücksichtigung der jeweiligen Wirtschafts- und Kolonialgeschichte erklärt. In vielen armen Ländern sei der gewachsene Einfluss der Pfingstkirchler*innen eng mit dem massiven neoliberalen Abbau des Sozialstaates verknüpft gewesen. Kirchen hätten häufig die Funktion der Sozialvorsorge übernommen, wie beispielsweise in den 1980er-Jahren in Uganda. Dort sei der Aufstieg der Evangelikal*innen massiv von US-amerikanischen Geldgebern unterstützt worden, und das Land zeichne sich heute durch eine besonders homophobe Gesetzgebung aus. Mit ähnlicher Etikettierung von Gender als einem ,dekadenten westlichen Import’ habe Victor Orbán die Gender Studies Programme aus Ungarns Hochschulen verbannt, und Putin in Russland über „Gayropa” gelästert. Butler sieht darin im Anschluss an Graff und Korolczuk ebenfalls eine konservative Reaktion auf die sozial verheerenden Folgen des Neoliberalismus.[3] Deshalb fordert Butler, dass der Kampf gegen Rechts „mit dem Kampf gegen Kolonialismus, Imperialismus und Verschuldung verknüpft werden” müsse (S. 97).
Inzwischen haben sich Butler zufolge auch rechte Frauen wie Georgia Meloni in Italien und hinduistische Staatsführer wie Narendra Modi der „globalen Szene“ gegen „Gender” verschrieben. Gruppierungen wie die 2013 in Spanien gegründete Internetplattform CitizenGo, die in Deutschland zuletzt erfolgreich die Kampagne gegen die Kandidatur der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf für das Bundesverfassungsgericht betrieb, oder der in den USA ansässige, aber weltweit vernetzte World Congress of Families (WCF) finanzieren Social-Media-Kampagnen und internationale Kongresse „zur Verteidigung der Familie” und werden dabei von Millionen Anhänger*innen unterstützt. Diese Bewegungen sind nicht nur anschlussfähig an ethnonationalistische Vorstellungen von der ,richtigen‘, das heißt heterosexuell orientierten Familie als Fundament der Nation, sondern auch an Verschwörungsmythen wie das rassistische Phantasma des „großen Austauschs” (durch Immigration). „Gender” wird darin als existenzielle Bedrohung imaginiert – verkörpert vor allem durch Feminist*innen und LGBTQIA+-Personen, denen unterstellt wird, sich nicht fortpflanzen zu wollen und auch Jugendliche davon abzuhalten, oder ungeborene Kinder durch Abtreibung zu töten. Ähnlich abstruse Assoziationsketten wie in dem immer breiter rezipierten Diskurs, der Gender Studies und alles Queere für das soziale Auseinanderdriften der Gesellschaften verantwortlich macht, werden mittlerweile auch hierzulande mehr oder weniger offen von Vertreter*innen staatlicher Institutionen propagiert, wie unlängst etwa die amtierende deutsche Bundestagspräsidentin anschaulich unter Beweis stellte. Diese und etliche andere aktuelle Tendenzen und Entwicklungen werden von Butler aufgegriffen und thematisiert. Die inzwischen ziemlich breite Forschung zur rechten Obsession mit Gender, auf der deren Ausführungen und Argumente aufbauen – sei es zu rechten Mustern der Vergeschlechtlichung und zu globalen Angriffen auf Genderrechte, sei es zu Konzepten wie „Anti-Genderismus”, „Femonationalismus”, „sexuellem Exzeptionalismus”, „Ethnosexismus” oder zum „rechten Anti-Gender-Komplex” – adelt Butler allerdings nur sehr selektiv durch Zitation.
In den USA fasste die Anti-Gender-Bewegung erst relativ spät Fuß, nachdem evangelikale Gruppen das Thema „Trans” in den Fokus rückten und die Bischofskonferenz 2019 einen am vatikanischen Diskurs orientierten Leitfaden für den Schulunterricht zu Sexual- und Gendervielfalt veröffentlichte. Seither rahmen die Kritiker*innen ihren Kampf gegen Gender als Kampf für den Schutz von Kindern und sogenannten natürlichen Frauen, was in der Konsequenz die Stärkung patriarchaler Macht und eines maskulinistischen Staates bewirkte. In der Folge wurden Rechte queerer Menschen massiv eigeschränkt oder zurückgenommen.[4] Am Beispiel der sogenannten TERF-Bewegung (Trans-Exclusionary Feminists), zeichnet Butler vor diesem Hintergrund sehr ausführlich eine weitere phantasmatische Umkehr über eine spezifische Lesart von Gender nach. TERFs, so Butler, lehnten dekonstruktivistische Ansätze ab, denen zufolge Geschlecht (auch) sozial konstruiert und somit veränderbar ist. Die britische Schriftstellerin J. K. Rowling beispielsweise führe ihre persönlichen Gewalterfahrungen mit Männern ins Feld, um Transfrauen den Zugang zu öffentlichen Damentoiletten und Frauengefängnissen zu verbieten. TERFs verweigerten somit Transmenschen eben jene Grundrechte wie Selbstbestimmung, Freiheit und Autonomie oder Schutz vor Gewalt, die sie für sich selbst „als Frauen” einforderten. Die Bedrohung sexualisierter Gewalt werde auf Transfrauen projiziert, die entgegen ihrer Selbstzuschreibung nicht nur weiter als Männer, sondern als potenzielle Täter und permanente Bedrohung, für ,echte‘ Frauen gelesen würden. Butler besteht darauf, dass TERFs keine Feminist*innen seien, solange sie sich mit dem rechten Anti-Gender-Projekt gemein machen. Abschließend ruft Butler zu breiten feministischen Bündnissen auf, die auch für die Rechte von Transmenschen und LGBTQIA+ kämpfen.
Im zweiten Teil des Buches versucht Butler, weit verbreitete Vorwürfe zu entkräften, etwa die Behauptung, die Gender-Theorie leugne biologische Unterschiede und mache über eine dekonstruktivistische Vorstellung von Gender den Schutz vor Diskriminierung aufgrund von Geschlecht unmöglich. Butler rekapituliert zentrale Fragen und Debatten der Gender Studies. Dazu zählt die feministische Grundforderung, Frauen nicht ausschließlich über ihre biologische Reproduktionsfähigkeit zu definieren, und die, dass viele Menschen sich nicht mit vorgegebenen binären Geschlechterrollen identifizieren. Geschlecht sei aus historischer Perspektive stets Teil von sozialen Klassifizierungssystemen gewesen und eine Kategorie, „die Arbeitsteilung, das Ordnungsgefüge von Staaten und die ungleiche Verteilung von Macht beschreibt” (S. 340). Wenn man die Mechanismen hinterfrage, durch die es auf bestimmte Weise etabliert wird und diejenigen gewaltvoll ausschließt, die den Normen nicht entsprechen, werde Geschlecht keineswegs negiert.
Um sich über Gender auch der Materialität von Körpern und dem biologischen Geschlecht anzunähern, wie Butler bereits in deren Buch Körper von Gewicht (1993) argumentiert hat, schlägt Butler zwei Erweiterungen vor: ein Verständnis von Gender als „Ko-Konstruktion” (S. 61) zwischen den Sphären der Kultur und der Natur und die Ergänzung der „anglophonen Gender-Theorien” um einen Fokus auf die „toxischen Phantasmen” (S. 293) von kolonialer Macht und vom Erbe der Sklaverei. Ein solcher Fokus sei wichtig, um deren prägenden Einfluss auf „das, was die Materialität von Körpern genannt wird” (S. 293), in den Blick zu bekommen – eine Forderung, die von Schwarzen Feminist*innen schon seit langem erhoben wird. Ihre Auseinandersetzung mit den Werken von Theoretiker*innen des Black Feminism wie Hortense Spillers und dekolonialen Perspektiven aus dem sogenannten Globalen Süden, denen sie sich im 9. Kapitel zuwendet, fällt allerdings eher oberflächlich aus. Butler zitiert in diesem Zusammenhang unter anderem die argentinische Philosophin María Lugones, die gezeigt hat, wie koloniale Gewalt global unterschiedliche und ungleiche Genderpositionen für Kolonisierte und für Kolonisierende erzeugt und weit verbreitete Geschlechterrollen und Verwandtschaftskonzepte, die nicht biologisch und binär begründbar sind, delegitimiert habe. Folglich hält Butler die Position des Vatikan für problematisch, weil sie „von der Vorstellung ausgeht, diese ,lokalen Gemeinschaften’ seien niemals queer oder schwul oder transgender gewesen” (S. 304). Um die „Möglichkeitsbedingung der Gender-Theorie in einem globalen Rahmen” (S. 21) zu erfüllen, ruft Butler zur „Ausarbeitung einer multilingualen Epistemologie” auf und plädiert dafür, sich „Gender als Ort der Übersetzung” (S. 320) vorzustellen. Die bahnbrechenden Arbeiten von Chicana-Feminist*innen wie Gloria Anzaldúa, die schon seit den 1980er-Jahren Vielsprachigkeit, Übersetzung und „Dazwischensein” als zentrale Arenen und zukunftsweisende Orte neuer Bündnisse aufgefächert haben, wären hier gewinnbringend zu ergänzen. In deren Geiste fordert Butler dazu auf, die gegenwärtigen spalterischen Tendenzen und die rechte Gewalt gegen Gender mittels „Allianzen, Übersetzung und ein Gegenimaginäres” zurückzudrängen. Besonders auch mit Mitteln der Kunst gelte es, „Gender wieder zu etwas Verheißungsvollem zu machen” (S. 334).
Wer hat Angst vor Gender? ist eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der weltweit wachsenden Bedrohung von Gleichstellung, Diversity und Genderrechten. Dankenswerterweise nutzt Butler deren Prominenz in dieser schwierigen Situation, um wirkmächtige Akteure, Narrative und Tendenzen zusammenzuführen und deren Strategien zu entlarven. Ärgerlich ist jedoch, dass Butler dieses hehre Ziel verfolgt, ohne einen Großteil der in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren veröffentlichten wegweisenden Forschung zur rechten Instrumentalisierung von Gender und zum rechten Anitfeminismus zu nennen. Ton und Stil Butlers Ausführungen sind vom poststrukturalistisch geprägten Duktus mit seinen zahlreichen Denkschleifen und Wiederholungen geprägt, dessen fesselnder Effekt sich in der Übersetzung allerdings zuweilen verliert. Der Text selbst argumentiert vehement für die Existenz von vielfältigen geschlechtlichen Existenzweisen, Familien- und anderen Verwandtschaftsformen. Für Leser*innen, die mit den Entwicklungen im Bereich der Gender Studies und mit Butlers Arbeiten vertraut sind, ergeben sich im Zuge der Lektüre nicht unbedingt viele neue Einsichten. Das verwendete Konzept des Phantasmas ist zwar eingängig, wird aber nicht weiter ausgeführt oder theoretisch unterfüttert. Butlers Darstellung fasst grundlegende Ansätze des breiten Felds der Gender Studies exemplarisch und anschaulich zusammen und aktualisiert diese für einen globalen Kontext und Diskurs. Insgesamt ist das Buch – und das ist vielleicht sein eigentliches Verdienst – in deutlich zugänglicherer Sprache geschrieben als etliche andere Arbeiten Butlers. Der für ein breites Publikum gedachte Text will aufklären und mit Mythen und Vorurteilen aufräumen, wobei Butler selbst darauf hinweist, dass die Feind*innen der Gender-Theorie entsprechende Texte kaum lesen. Das gilt auch für manche deutsche Feuilleton-Autoren (gendern unnötig), die Butler bis hin zu einer Mitverantwortung für die Machtergreifung Donald Trumps alles Mögliche unterstellen,[5] obwohl sie deren Texte ebenso wenig zu kennen scheinen wie die des genauso verteufelten Postkolonialismus. Die Darstellung dieser seitens der Kritiker(*innen) mit inniger Abneigung geführten Beziehung böte Stoff für ein eigenes Buch.